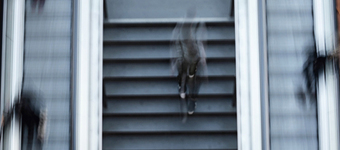Nostalgie, Brüche und Lebenswege
Warum Ost- und Westdeutsche einander im 20. Jahr der Einheit noch immer nicht verstehen - sich aber in der Zukunft besser verstehen werden
Im zwanzigsten Jahr der deutschen Einheit kennen Ost- und Westdeutsche einander noch immer nicht. Das belegen zahlreiche Studien über das deutsch-deutsche Verhältnis. In einer Umfrage der Universität Bielefeld aus dem Jahr 2008 gaben 67,4 Prozent der Ost- und 55,3 Prozent der Westdeutschen an, die Bewohner der beiden Landesteile seien „grundverschieden“. Erklären lässt sich dieses Ergebnis vor allem auch mit dem geringen Kontakt zwischen „Ossis“ und „Wessis“: Nur knappe 20 Prozent der Westdeutschen haben ostdeutsche Bekannte oder Freunde. Andersherum liegt die Quote bei immerhin 33,8 Prozent. Dazu passt, dass Westdeutsche den Osten kaum kennen, selten dorthin reisen und sich auch nicht wirklich für die neuen Bundesländer zu interessieren scheinen. Umgekehrt gilt das nicht. Dieses Desinteresse hat über die Jahre zu Stereotypen und Vorurteilen geführt, die Misstrauen stiften.
Man könnte mit diesen Einheitsritualen souverän umgehen. Schließlich belegen viele Freundschaften, Ehen und Arbeitsbeziehungen, dass ein gutes Verhältnis zwischen West- und Ostdeutschen nicht zuletzt eine Frage der Kommunikation ist. Außerdem sind Unterschiede zwischen einzelnen Landesteilen in Europa gang und gäbe. Doch so einfach ist es nicht. Es gibt einen ernst zu nehmenden Kern in dieser Debatte, der die Grundfesten der Einheit betrifft. Das Zusammenleben könnte auf Dauer belastet werden, wenn sich in beiden Landesteilen ein falsches Bild verfestigt und die Erinnerung an die „gute alte Zeit“ den Blick auf gegenwärtige Probleme und Lösungswege verstellt.
Generell wird das Thema Ostdeutschland in den bundesweiten Medien nur
verkürzt behandelt. In ihrer Studie Die Ostdeutschen in den Medien (2009) haben Wissenschaftler aus Jena, Leipzig und Wien gezeigt, dass die überregionalen Medien eingeschliffene Bilder von Ostdeutschland verfestigen. Eine der Ursachen dafür lautet, dass westdeutsche Medien im Osten kaum Verbreitung finden. Die Medien produzieren Inhalte für ihre Zielgruppe, und das Selbstbild vieler westdeutscher Medienkonsumenten wird nun einmal auch über die Abgrenzung zum Osten definiert.
Auf der anderen Seite arbeiten in ostdeutschen Verwaltungen, Landesparlamenten und Kabinetten seit zwei Jahrzehnten viele Westdeutsche. Dies hatte in der Wendezeit sicher seinen Sinn, zumal die regionale Herkunft bei politischen Karrieren keine Rolle spielen sollte; alles andere wäre vor dem Hintergrund der europäischen Einheit und Globalisierung geradezu provinziell. Umso erstaunlicher, dass Johanna Wanka im Jahr 2010 die erste ostdeutsche Politikerin war, die als Ministerin in eine westdeutsche Landesregierung berufen wurde. Ob dies als Zeichen einer Normalisierung gewertet werden sollte, darf mit Blick auf die aktuelle Bundesregierung bezweifelt werden: Kein einziger Minister der Regierung Angela Merkel ist in der DDR aufgewachsen. Paradoxerweise steht dieser mangelnde personelle Austausch in der Politik im Gegensatz zum innerdeutschen „brain drain“. Laut Statistischem Bundesamt haben in den Jahren zwischen 1991 und 2009 rund 1,5 Millionen Menschen die neuen Bundesländer in Richtung Westen verlassen. Viele Unternehmen in den alten Bundesländern stünden ohne diese innerdeutsche Migration schon längst vor erheblichen personellen Problemen.
Darüber hinaus tragen die persönlichen Erfahrungen zum geringen Verständnis zwischen den neuen und den alten Bundesländern bei. Ein Besuch in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn gibt Aufschluss über die westdeutsche Erzählung von Aufstieg und Stabilität. Ein „Weg der Demokratie“ führt durch das ruhige ehemalige Regierungsviertel. Für jemanden, der – wie ich – in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist, fühlt sich Bonn behaglich an. Dieser Eindruck wird im Haus der Geschichte bestätigt. Die Besucher erleben den Aufstieg der Bundesrepublik über mehrere Etagen geradezu physisch. Vom Rosinenbomber im Erdgeschoss zum ersten Bundestag, zum Käfer, zur Pille, zu Robotern, zu Helmut Kohl.
Zweifellos war die alte Bundesrepublik eine ökonomische und soziale Erfolgsgeschichte: Von 1950 bis 1973 verzeichnete das Land ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von satten fünf Prozent. In den fünfziger und sechziger Jahren gab es Vollbeschäftigung und kräftige Lohnzuwächse für die Arbeitnehmer. Immer mehr Menschen konnten studieren. Hatte man den Studienabschluss oder eine Berufsausbildung in der Tasche, stand dem wirtschaftlichen Aufstieg eigentlich nichts mehr im Wege. Vor allem die Generation, die zwischen den späten vierziger und den frühen sechziger Jahren geboren wurde, konnte ihr Leben erfolgreich aufbauen (wovon natürlich auch ihre Nachkommen profitierten).
Das ostdeutsche Narrativ geht anders
Es ist diese Generation, die in den vergangenen Jahren Medien, Wirtschaft und Politik prägte. Und es ist diese Generation, die allzu häufig der Versuchung nicht widerstehen kann, den sozialen Aufstieg als eigenes Verdienst und als Blaupause für die heutige Gesellschaft zu sehen. Doch das ist ein Irrtum. Weder das Wirtschaftswachstum noch der Aufstieg durch Bildung lassen sich allein mit Fleiß oder Ehrgeiz einzelner Personen erklären; entscheidend sind vielmehr weltweite Rahmenbedingungen, wirtschaftspolitische Maßnahmen und eine progressive – sozialdemokratische! – Bildungspolitik. So nachvollziehbar der Mythos vom Aufstieg durch eigene Anstrengung für das individuelle Selbstbild ist, so hinderlich ist er im Dialog zwischen West- und Ostdeutschen und bei der Formulierung zeitgemäßer Politik.
Denn das Narrativ der ostdeutschen Gesellschaft geht anders. Es ist eine Erzählung von existenziellen Brüchen im Leben. Das kann man in persönlichen Begegnungen erfahren, aber auch mit nackten Zahlen untermauern: Im Osten stieg die Arbeitslosigkeit sprungartig zunächst auf knapp 10 Prozent im Jahr 1990 und dann bis zum Jahr 2005 kontinuierlich auf mehr als 20 Prozent an. Die vormaligen Auslandsmärkte der DDR brachen fast völlig weg, innerhalb weniger Monate reduzierte sich die Industrieproduktion um die Hälfte. Dem Mannheimer Politologen Thorsten Faas zufolge hat jeder zweite Ostdeutsche persönliche Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit gemacht. Zudem wurden in den neunziger Jahren ganze Kohorten von Arbeitnehmern an der Arbeitslosigkeit vorbei in den vorzeitigen Ruhestand geschleust.
Die ostdeutsche Generation der zwischen den vierziger und frühen sechziger Jahren Geborenen hatte mit der Einheit am meisten zu kämpfen. Viele Menschen in den neuen Bundesländern haben den Systemwechsel und die wirtschaftlichen Folgen nicht gut überstanden und sind teilweise daran zerbrochen. Sicher, die meisten haben die große Transformation erstaunlich erfolgreich gemeistert. Doch selbst wenn sie heute in relativem Wohlstand leben, mussten sie die Umbruchphase doch als existenzielle Bedrohung empfinden. Die regelmäßig in Richtung der Ostdeutschen erhobene Forderung nach „Dankbarkeit“ ist vor dem Hintergrund dieser persönlichen Schicksale grotesk und nur mit mangelndem Verständnis für die ostdeutschen Biografien zu erklären.
Um die Jahrtausendwende entwickelte sich das Phänomen der so genannten Ostalgie. Filme wie „Sonnenallee“ (1999) und Fernsehsendungen wie die „DDR-Show“ genossen großen Zuspruch. Doch es gibt auch eine andere Seite der Ostalgie: das Fremdeln vieler Bürger der neuen Bundesländer mit dem politischen System der Bundesrepublik, verbunden mit einem verklärten Blick in die DDR-Vergangenheit.
An dieser Stelle soll nicht noch einmal die gesamte Diskussion über die Verklärung der DDR geführt werden. Zweifellos war die DDR eine Diktatur, die grundlegende Freiheitsrechte für ihre Bürger nicht gelten ließ. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass für gesellschaftliche Transformationsprozesse kennzeichnend ist, dass sie Jahrzehnte brauchen. Dies galt auch für die Nachkriegsgesellschaft Westdeutschlands. Ebenso wenig darf aus dem Blick geraten, dass es eine politische Partei gibt, die ein Interesse an der Weichzeichnung der DDR-Vergangenheit hat und die Klaviatur aus Nähe und gleichzeitig vermeintlicher Distanz zum untergegangen Staat elegant zu spielen weiß.
Doch Nostalgie ist keineswegs ein ostdeutsches Phänomen. Viele Bürger im Westen blicken ebenso wehmütig auf ihre Vergangenheit. Der fundamentale Unterschied zwischen der Ost- und der Westnostalgie besteht darin, dass die westdeutschen Accessoires nicht verschwunden sind. Ketzerisch gefragt: Wozu soll man eine „BRD-Show“ im Fernsehen ausstrahlen, wenn „Wetten, dass ...?“ und „Lindenstraße“ unverdrossen gesendet werden? Das Alltagsleben hat sich in Westdeutschland mit der Einheit eben nicht grundlegend geändert. Das Leben ging weiter.
Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise ist mit keinem Konjunktureinbruch in der Geschichte der Bundesrepublik vergleichbar. Wie bereits erwähnt lag der Rückgang im Jahr 1975 bei knapp einem Prozent. Die Rezession des Jahres 2009 betrug minus fünf Prozent. Die Folgen der Krise sind nicht einschätzbar. Bislang konnten engagierte Konjunkturprogramme und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen die Auswirkungen des Einbruchs dämpfen. Einen weiterhin „milden“ Verlauf der Krise kann jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand ernsthaft prognostizieren; auch die derzeit günstige Konjunkturentwicklung bietet dafür angesichts der labilen weltwirtschaftlichen Konstellation keine Gewähr.
Ende des westdeutschen Urvertrauens
Diese Krise ist keine bloße Konjunkturdelle. Vielmehr handelt es sich um eine wirkliche Zäsur in der wirtschaftlichen Entwicklung der Nachkriegszeit. Sie wird das Ende des westdeutschen Urvertrauens in die soziale Marktwirtschaft markieren. Diese These mag man als gewagt empfinden, doch das auffallende Merkmal dieser Krise ist die Unkontrollierbarkeit. In den Medien, in privaten Gesprächen und politischen Debatten schimmert das Gefühl durch, im schlechtesten Fall könnte sowohl das Wirtschaftssystem als auch der erarbeitete Wohlstand gefährdet sein. Und dies nicht durch einen vermeintlich ausufernden Sozialstaat oder hohe Steuern und Arbeitskosten, sondern durch die Marktkräfte selbst.
Dieses Gefühl hat Ursachen. Ein unübersichtlicher internationaler Finanzmarkt, der esoterisch anmutende Geldmarktderivate hervorbringt und sich gegen jegliche Art von Regulierung wehrt, schafft kein Vertrauen. Die billionenschweren Rettungsschirme der Regierungen, um damit – vermutlich – das Schlimmste zu verhindern, tragen ebenso wenig zur Beruhigung bei.
Zweifellos gehören zum Kapitalismus auch existenzbedrohende Krisen. In seinem aktuellen Buch Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft nimmt der amerikanische Ökonom Nouriel Roubini schwere Wirtschaftskrisen der vergangenen zwei Jahrhunderte aus allen Weltregionen in den Blick. Staaten wie Argentinien, Japan oder Indonesien können ein Lied davon singen. Neu ist diese Art von Krise also nicht, sie kommt noch nicht einmal überraschend. Doch aus Sicht der westdeutschen Gesellschaft gilt: Das Versprechen einer Marktwirtschaft, die kontinuierlich Wohlstand schafft, wurde bereits in den letzten zwei Jahrzehnten der alten, westdeutschen Bundesrepublik strapaziert. Nun ist es gebrochen. Die Aufstiegsprosa hat ausgedient.
Dieser Bruch ist eine gemeinsame Erfahrung der Bevölkerung in allen Bundesländern. Der Vorteil der Ostdeutschen besteht darin, dass sie Brüche kennen. Von diesem Gedanken ausgehend sind zwei Szenarien denkbar: In einem negativen Szenario sinkt die Zustimmung zu Marktwirtschaft und dem politischen System, und die Bevölkerung nimmt den beschriebenen Bruch als weiteren Beleg dafür, dass die Bundesrepublik nichts taugt. Die Gesellschaft verliert weiter an innerer Solidarität, und angesichts knapper Mittel wird die Forderung nach individueller Anstrengung zum Dogma erhoben, letztlich um Kürzungen und Aufweichungen zu rechtfertigen.
Doch auch ein positives Szenario ist denkbar: Die Gesellschaft – besonders die westdeutsche – wird von der Überzeugung abrücken, dass durch individuelle Anstrengung alles erreichbar sei. Sie wird zur Kenntnis nehmen, dass es prekäre Lebenssituationen gibt, die nichts mit individuellen Entscheidungen zu tun haben und deshalb durch eine Solidargemeinschaft abgefedert werden müssen. Das Verständnis für ostdeutsche Erfahrungen und Lebenslagen wird zunehmen.
Am wahrscheinlichsten ist es, dass beide dieser entgegengesetzten Überzeugungen Anhänger entlang der politischen Lager finden werden. Letztlich wird es auf politische Mehrheiten ankommen. Doch eines ist unbestreitbar: Ost- und Westdeutsche erleben in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise der Gegenwart erstmals einen gemeinsamen Bruch. Die zwei Erzählungen, die sich bisher sozial, ökonomisch und emotional unterscheiden, werden zu einer gemeinsamen Geschichte. «