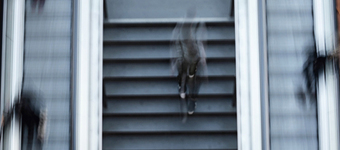Die Rache der vertagten Selbstaufklärung
Die SPD muss sich aufs Regieren in der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts vorbereiten. Sonst wird sie erneut in einen Kreislauf aus unverstandenen Reformen, Wählerenttäuschung, Machtverlust und Identätskrise gerate
Es ist keine Schwarzmalerei, die bisherigen Leistungen der schwarz-gelben Koalition, gemessen an den aktuellen Problemen und bestehenden Erwartungen, als unzureichend zu klassifizieren. Doch ist der Umkehrschluss falsch, jede andere Regierungskonstellation würde ein besseres Bild abgeben. Die allgemeine Unzufriedenheit führt noch nicht einmal automatisch dazu, dass die Oppositionsparteien in der Wählergunst steigen. Und selbst wenn, so bliebe es im neuen Fünf-Parteien-System ungewiss, welche Parteien in einer anderen Regierungskoalition schließlich zusammenfinden würden.
Die Frage nach den Chancen einer neuen Mitte-Links-Regierung in Deutschland wird allzu häufig auf die Profilnähe von SPD und Grünen sowie die Regierungs(un)fähigkeit der Linkspartei reduziert – als ob es bei der Ablösung von Schwarz-Gelb nur um die Addition von Umfragewerten ginge. Da ist ein Blick zurück aufschlussreich: Während konservativ-liberale Regierungen regelmäßig von Kontinuitätserwartungen und Veränderungsfurcht profitierten, gelangten die zwei SPD-geführten Regierungen Brandt-Scheel und Schröder-Fischer auf einer Welle dezidierter Modernisierungshoffnungen ins Amt. Ihre Wahlerfolge verdankten sie ihrer Fähigkeit, aus erkennbar veränderten Umständen „richtige“ Konsequenzen zu ziehen: einstmals im Verhältnis zur DDR, zu Polen und der Sowjetunion, später im Verhältnis von Staat, Wirtschaft und Umwelt sowie hinsichtlich des Status’ gesellschaftlicher Minderheiten. Was im Nachhinein gern als wohlüberlegtes „Projekt“ beschrieben wird, war vor allem die überfällige, schon diskursiv vorbereitete Ratifizierung irreversibler Veränderungen in der Umwelt der Politik.
Wenn dieses Muster die Erfolgsformel für einen Regierungswechsel von Mitte-Rechts zu Mitte-Links ist, kann ein sozialdemokratischer Wahlerfolg nicht allein auf Versprechungen für die eigene Wählerklientel basieren. Um Wahlen für Mitte-Links zu gewinnen, braucht es mehr.
Nach dem Aufbau des modernen Sozialstaats in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ist die europäische Sozialdemokratie heute mit einem dreifachen Dilemma konfrontiert. Erstens ist ihre Stammwählerschaft nicht groß genug, um sie ohne Unterstützung aus der breiten Mittelschicht an die Regierung zu bringen. Ihr Profil muss sich deutlich von dem der Konservativen unterscheiden, aber gleichzeitig noch für die Mitte des Wählerspektrums – also für den median voter – attraktiv sein. Daraus resultiert das zweite Dilemma: Sozialdemokratische Parteien können zwar mittels einer Verbindung von Modernisierungs- und Umverteilungspolitik an die Regierung gelangen, werden aber in Folgewahlen regelmäßig von ihren Stammwählern bestraft, wenn sie den längerfristigen Bedingungen wirtschaftlicher Prosperität größere Beachtung schenken.
Versuchen sie dann, dieses Handicap durch straffe Führung oder mehr Mitgliederpartizipation zu überwinden, droht Dilemma Nummer drei: Mit erhöhter Führungsstärke und Vorgaben von oben werden Heimatgefühl und Mitwirkungswünsche der Mitglieder zwangsläufig frustriert; öffnet sich die dagegen Partei den vielfältigen, oft emotional gefärbten Mitgliedermeinungen, vermag sie schwerlich dem gesellschaftlichen Steuerungsbedarf gerecht zu werden.
Drei Mehrheiten in Deutschland
Trotz derart vertrackter Erfolgsbedingungen konnte die SPD 1998 zusammen mit den Grünen die Kohl-Regierung ablösen. Diesen Wahlerfolg erklärt der Politikwissenschaftler Joachim Raschke damit, dass zwei auf Veränderung drängende Mehrheiten in der Wählerschaft zusammenkamen: Es gab sowohl eine „ökologisch-kulturelle“ Mehrheit als auch eine an Gerechtigkeitsdiskursen orientierte „soziale“ Mehrheit für die Unterstützung der politischen Ziele von SPD und Grünen. In der Summe konnten sie sich gegen die eher konservativ-liberal orientierte „ökonomische“ Mehrheit durchsetzen.
Obwohl die rot-grüne Regierung einen Großteil ihrer Reformziele erreichte und dabei in der Wirtschaftspolitik Liberalisierungsschritte riskierte (die sich nicht zuletzt in der Finanzkrise bewährten, wie die rasche Erholung der deutschen Wirtschaft zeigt), stolperte sie in der zweiten Legislaturperiode über ihre rasch in Verruf geratenen, wenngleich keineswegs erfolglosen Arbeitsmarktreformen. Hatte man den Erwartungen der „ökologisch-kulturellen“ Mehrheit im Großen und Ganzen genügen können, so wurde die Agenda 2010 als ostentativer Bruch mit dem originären Gerechtigkeitsversprechen wahrgenommen.
Aufklärung sollte man nie vertagen
Dabei hatte schon die heftige Kritik am Schröder-Blair-Papier von 1999 signalisiert, dass große Teile von Mitglied- und Wählerschaft denkbar schlecht auf eine problemgerechte Regierungspolitik vorbereitet waren. Die Bewältigung des strukturellen Wandels, den die Globalisierung und der Aufstieg neuer Industrieländer mit sich bringen, war für „Mitte-Links“ einfach noch nicht zum Thema geworden. Vor dem Hintergrund der Oppositionsrhetorik der vergangenen Jahre leuchtete es höchstens einer Minderheit ein, warum scheinbar ewig geltende Identitätspfeiler abgetragen werden sollten: die Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit als Gleichheit im Ergebnis; ein Fortschrittsverständnis, das im Wachstum öffentlicher Ausgaben aufgeht; die Unterstellung, der Staat könne die Individuen jederzeit vor den Risiken und Folgen des wirtschaftlichen Wandels schützen und ihnen eigene Vorsorgepflichten ersparen; und nicht zuletzt der auf Gegenwartsbedürfnisse beschränkte Zeithorizont, mit dem sich die Verantwortung für die Beitragszahler und Rentner der Zukunft ignorieren ließ.
Doch die Welt, an der sich verantwortungsbewusste Entscheidungen orientieren müssen, steckt seit den neunziger Jahren in einem dramatischen Veränderungsprozess. Das Kräftezentrum der Weltwirtschaft verlagert sich von den alten zu den neuen Industrieländern. Deren hohe Wachstumsraten sorgen für eine Beschleunigung des strukturellen Wandels, den derzeit alle Volkswirtschaften durchmachen – in Richtung Dienstleistungs-, Wissens- und Kommunikationsökonomie auf einer demnächst radikal veränderten (kohlenstoffarmen) Energiebasis. Der forcierte Wandel wird paradoxerweise vor allem jenen Ländern Probleme bereiten, die frühzeitig soziale Sicherungssysteme mit hohem Strukturierungs- und Beharrungsvermögen institutionalisiert haben, also den westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten. Die hier bestehenden Sicherungssysteme und Normalitätsvorstellungen reflektieren heute eine obsolet werdende Risikostruktur, bei der nicht nur der demografische Wandel, sondern auch die Dynamisierung von Sektoral-, Qualifikations- und Sozialstruktur unberücksichtigt sind – ebenso wie die fiskalpolitisch untragbaren, aber dennoch weiter anwachsenden Staatsschulden.
Diese Probleme zu ignorieren, Selbstaufklärung und gesellschaftliche Bewusstmachung zu vertagen, hat fatale Folgen. Die Vorboten traten schon in der Kampagne gegen das Reformpaket der Agenda 2010 zutage. Im Bemühen, den Kollaps der Sozialfinanzen abzuwenden, unterließ man es fahrlässig, auch den Wohlhabenden und Besserverdienenden einen Solidaritätsbeitrag abzuverlangen (den sie, nach allem was man heute weiß, mit Murren, aber ohne Widerstand akzeptiert hätten). Ebenso wichtig wäre es gewesen, mithilfe von Investitionserleichterungen und einigen gezielten Liberalisierungsschritten für eine deutlich erhöhte Arbeitsnachfrage von Industrie und Handwerk zu sorgen, anstatt die Mehrzahl der Hartz-IV-Empfänger vor die Wand laufen zu lassen.
Das neue Fünf-Parteien-System macht die Vorbereitung auf die notwendigen Reformen nicht eben leichter. So haben die „Volksparteien“ jederzeit die Möglichkeit, dem Stress eines Drei-Parteien-Bündnisses durch die Vereinbarung einer Großen Koalition auszuweichen. Und diese funktioniert desto besser, je weniger man sich im Vorhinein festgelegt hat. Das heißt umgekehrt: Um die Chance für eine handlungsfähige Zwei-Parteien-Koalition zu erhöhen, bedarf es profilbildender Festlegungen, die beide Partner als hinreichend kompetent ausweisen – und zwar auf mehreren Ebenen.
Warum der „dritte Weg“ kein Irrweg war
Der Wahlsieg Willy Brandts verdankte sich nicht zuletzt dem Umstand, dass die Unionsparteien sich 1969 weder eine ökonomische, noch eine kulturelle, geschweige denn eine soziale Mehrheit verschaffen konnten. Dagegen hatte die SPD auf jeder dieser Ebenen ein überzeugendes Angebot vorzuweisen. Es ist nicht zu erwarten, dass sich dieser Idealfall wiederholt. Um die kulturelle Mehrheit gewinnen zu können, fehlt es an prägnanten Konflikten. Eine Wiederbelebung des Gegensatzpaares konservativ-progressiv könnte angesichts der schleichenden Enttraditionalisierung der CDU und des dortigen Generationswechsels sogar ungewollte Folgen haben. Aber mit Gerechtigkeits- und Umverteilungsdiskursen, wie sie die derzeitige Abkehr von der Agenda 2010 bestimmen, ist die Mitte des Wählerspektrums nicht zu gewinnen, zumal die Linkspartei als skrupelloser Wettbewerber mitmischt.
Folglich hat die SPD – unter der ceteris-paribus-Bedingung – nur dann eine Chance, wieder an die Regierung zu kommen, wenn ihr die amtierenden Parteien mit einer Kaskade offenkundiger Fehler den Weg bahnen. Jenseits dieser Bedingung sieht es besser aus. Verstünde man es, die landauf und landab verdrängte Problemkonstellation vor dem Hintergrund rationaler Politikvorschläge bewusst zu machen, könnte man als kompetenter Modernisierer in den Wahlkampf ziehen und womöglich auf eine ökonomische Mehrheit setzen. Dazu empfiehlt sich eine nüchterne Bestandsaufnahme aller im letzten Jahrzehnt erfolgten (Dis)Kurswechsel und besonders die Wiedervorlage der einst allzu rasch beiseite geschobenen Überlegungen zum „Dritten Weg“. Der Begriff selbst mag zwar überholt sein, die meisten der seinerzeit beschriebenen Grundsätze und Reformfelder sind es nicht. Einige, wie das Prinzip „fordern und fördern“, sind längst Wirklichkeit geworden; andere, wie Konzepte des „empowerment“ und die gemeinwohlorientierte Mobilisierung nichtstaatlicher Potenziale, verdienen dringend wieder mehr Aufmerksamkeit.
Es macht also wenig Sinn, jene schwierigen Klärungsprozesse zu vertagen, die die SPD befähigen, Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik auf der Höhe der Zeit zu betreiben. Denn ohne eine diskursive und konzeptionelle Vorbereitung auf die Welt, wie sie ist, droht nur die Wiederholung des Zirkels aus unverstandenen Reformen, schmerzvoller Wählerenttäuschung, Machtverlust und Identitätskrise der Partei samt einer Dosis Realitätsverweigerung bei der Krisenbewältigung – mit anderen Worten: ein erneuter Marsch durch den Sumpf der oben beschriebenen Dilemmata. «