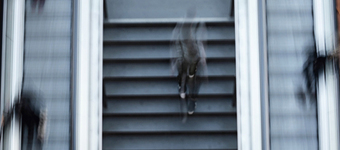Trauer und Hoffnung
Kurz vor seinem Tod hielt Tony Judt das im vorigen Jahrhundert Erkämpfte für verloren - und hoffte doch noch immer auf eine erneute Wende der Politik
Im Mai 1979 endete das sozialdemokratische Jahrhundert. Der Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien brachte Margaret Thatcher an die Regierung, und sie erklärte den britischen sozial- und gesellschaftspolitischen Konsens der Kriegs- und langen Nachkriegszeit für aufgehoben. Allenfalls Ronald Reagan war ebenso vehement in seiner Wortwahl. Nach seinem Wahlsieg im November 1980 forderte der neue amerikanische Präsident nicht weniger als die Rückentwicklung hinter den New Deal Franklin D. Roosevelts, der in unterschiedlicher Ausprägung seit Mitte der dreißiger Jahre Grundlage der amerikanischen (Sozial)Politik war. In anderen westlichen Staaten verlief der Bruch mit der Politik der Nachkriegszeit gradueller: In Israel ging 1977 die jahrzehntelange Vorherrschaft der Arbeitspartei zu Ende; in Skandinavien verloren die schwedischen Sozialdemokraten 1976 erstmals seit 1932 ihre Regierungsmehrheit, sechs Jahre später wurde die dänische Sozialdemokratie abgelöst; und in der Bundesrepublik zerbrach im Herbst 1982 die sozialliberale Koalition.
Differenz statt Egalität
Die politischen Veränderungen in den wichtigsten Industriestaaten brachten eine Entwicklung zu ihrem vorläufigen Abschluss, die bereits in der ersten Hälfte der siebziger Jahre eingesetzt hatte. Die Akzeptanz des permanenten sozialen Fortschritts und der Erweiterung der Demokratie war in der als krisenhaft empfundenen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dieser Zeit verloren gegangen. An die Stelle einer Fortentwicklung des Kollektivs trat die Idee eines entfesselnden Individualismus, begleitet von einer rasch voranschreitenden Deregulierung vieler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bereiche. Es begann die Erosion der alten sozialen Interessenvertretungen. Das Ziel der Egalität – verstanden als ein Korrektiv aller staatlichen Politik, nicht als im politischen Alltag zu verwirklichende Utopie – wich dem Ziel der Differenz. Kaum ein Historiker oder politischer Denker hat sich der Problematik dieses Epochenbruchs so intensiv gewidmet und diesen in seinen Ursachen und Folgen analysiert wie der große britische Historiker Tony Judt.
Wie für viele seiner Altersgenossen war der Epochenbruch für Judt von einer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Weichenstellung gekennzeichnet. Freilich hatte diese Entwicklung schon einige Zeit vorher begonnen. Judt zufolge waren bereits die siebziger Jahre der Epilog der „Meistererzählung“ des 20. Jahrhunderts – der Erwartung (und schrittweisen Verwirklichung) eines permanenten sozialen Fortschritts. In einer an Resignation gemahnenden Tonart konstatiert Judt in seinem Buch Geschichte Europas (2006): „Psychologisch waren die siebziger Jahre das deprimierendste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. ... Der abschüssige und anhaltende wirtschaftliche Niedergang verstärkte in Verbindung mit der weit verbreiteten politischen Gewalt das Gefühl, Europas ‚gute Zeiten‘ seien, vielleicht auf Jahre, vorbei. Den meisten jungen Leuten ging es weniger darum, die Welt zu verändern, als einen Arbeitsplatz zu finden: Die Begeisterung für kollektive Ziele wich der obsessiven Beschäftigung mit privaten Bedürfnissen.“ So war das: Die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen gingen einher mit kulturellen Veränderungen – und einer Veränderung des Bewusstseins. Die alte wohlfahrtsstaatliche Politik schien nicht mehr begründbar.
Meistererzählung des 20. Jahrhunderts
So wie Arthur M. Schlesinger die amerikanische Geschichte als eine Abfolge von Zyklen interpretiert, so ordnet auch Judt die Geschichte Europas in Zyklen („Erzählungen“), die wie konzentrische Kreise aufeinander folgen: mit dem gleichen Zentrum, aber unterschiedlichen Radien. Die große Geschichte der sozialen Emanzipation seit den Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts und der Aufstieg der Arbeiterbewegung bis zur politischen Wirklichkeit des „sozialdemokratischen Jahrhunderts“ (Ralf Dahrendorf) ist der große, äußere Rahmen für die „Meistererzählung des 20. Jahrhunderts“. Dazu gehörte die Hegemonie progressiver, sozialdemokratischer Politik seit Roosevelts New Deal und dem Sieg der demokratischen Kräfte in der Auseinandersetzung mit Faschismus und Nationalsozialismus, der in den Staaten der westlichen Welt zu einer Zähmung und Eingrenzung des Kapitalismus führte. Dazu gehörten der englische Wohlfahrtsstaat, der Fair Deal und die Great Society Präsident Johnsons sowie die verschiedenen Varianten einer sozial ausgerichteten Marktwirtschaft in Europa.
Dieser Zyklus, so Judt, war in den siebziger Jahren zu einem Ende gekommen. Die Idee der sozialen Emanzipation sei erschöpft gewesen und damit die jahrzehntelange soziale Emanzipation benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen vorerst abgeschlossen. Judt sah darin einen sozialen und kulturellen Prozess, der zu Verwerfungen führte und keine Antworten auf die Probleme der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts und den Beginn des 21. Jahrhunderts mit sich brachte. Aber auch für eine Fortsetzung sozialdemokratischer Politik fehlte die Begründung. Neue soziale Bewegungen und Fragen – die Entstehung neuer Unterschichten sowie die Probleme der globalen Migration – wurden nicht ernst genug genommen. Stattdessen ließen sich auch die Linken auf die nun erfolgreiche Ideologie des Individualismus und seines politisch-marktwirtschaftlichen Rahmens ein – oft angereichert mit einer gewissen Nostalgie für die (moralische) Sicherheit vergangener Zeiten.
Worüber wir wütender sein sollten, als wir es sind
Der Spanische Bürgerkrieg – das große Epos der Linken in den dreißiger Jahren – war für die Linke der achtziger Jahre längst bloße Reminiszenz und Anlass für Nostalgie. Das Ziel war nun das individuelle Glück. Ende der siebziger Jahre begann der Hexensabbat des Eigennutzes, der den Fortschritt der europäischen, nordamerikanischen und pazifischen Gesellschaften beendete. Diese Entwicklung trieb Judt in den letzten Jahren seines Lebens um. Als Historiker suchte er die Antwort in der Geschichte. Es war ein Versäumnis der progressiven Denker jener Zeit, die Idee der sozialen Gerechtigkeit nicht neu für die politische Praxis zu bestimmen. So führte der Epochenbruch zu einem Rückschritt, der sich vor allem in der anglo-amerikanischen Gesellschaft zeigte. Reagans „Revolution“ war im Kern der Versuch, den New Deal rückgängig zu machen und gleichzeitig – den militärischen Bereich einmal ausgenommen – einen minimalistischen Staat zu begründen. Margaret Thatcher verfolgte eine ähnliche Politik, als sie den Nachkriegskonsens aufkündigte, der den englischen Wohlfahrtsstaat konstituiert hatte, und das gesellschaftliche Prinzip der Wohlfahrt durch Individualismus ersetzte.
Es ist diese historische Betrachtung, die Judts politischen Essays zugrunde liegt, in denen er die sozialdemokratische Idee verteidigt. Die Rückbesinnung auf die große Erzählung des sozialen Fortschritts ist dabei weder konservativ noch nostalgisch. Die Vergangenheit – auch die der Sozialdemokratie – war nicht ideal, wie Judt an verschiedenen Stellen betont. Also kein Grund zur Nostalgie. Aber ihre Erfolge sind unverzichtbar für den Aufbau einer Zukunft: „Unvollkommene Verbesserungen als Antwort auf unbefriedigende Umstände – das ist das Beste, worauf wir hoffen können, und vermutlich sollten wir auch gar nicht mehr anstreben. Andere haben die vergangenen drei Jahrzehnte damit zugebracht, alle diese Verbesserungen systematisch wieder rückgängig zu machen und zu destabilisieren: Darüber sollten wir viel wütender sein, als wir es sind. Es sollte uns auch besorgt stimmen, und wenn auch nur aus Gründen ganz praktischer Vernunft: Warum sind wir in solch großer Eile gewesen, die Deiche niederzureißen, die unsere Vorgänger unter großen Mühen gebaut hatten? Sind wir so sicher, dass keine Fluten mehr kommen werden?“ Dieses Denken ist nicht konservativ, sondern eine Voraussetzung zukünftigen Fortschritts.
Sozialdemokratische Politik kann – für einen diese Politik als alternativlos sehenden Historiker – nur eine Form der Verteidigung sein. In Anlehnung an Judith Shklars liberalism of fear versuchte Judt in den drei nach-sozialdemokratischen Jahrzehnten eine solche Verteidigungsstrategie zu entwerfen – entgegen den Bemühungen verschiedener sozialdemokratischer Denker und Politiker, neoliberale Ideen und sozialen Fortschritt zu verbinden. Die jüngste Geschichte scheint ihm Recht zu geben: Weder Bill Clintons New Democrats, noch Tony Blairs New Labour, noch die Reformpolitik der rot-grünen Koalition in Deutschland konnten Judt als Gegenentwürfe zu einem konservativen Zeitgeist überzeugen. Das Scheitern der Modelle des „Dritten Wegs“ bestätigt seine Analyse. Wenn aber eine Alternative zu den neoliberalen und neokonservativen Konzepten fehlt, bedarf es zunächst einer Rückbesinnung. Das Erreichte muss verteidigt, das teilweise schon wieder Verlorene zurückgewonnen werden.
Retten, was noch zu retten ist
Eine solche Verteidigung aus „Furcht“ vor weiteren sozialen Verwerfungen ist nicht die schlechteste aller Strategien. Sie ist Voraussetzung für eine neue progressive Politik. Es war der „Fehler“ sozialdemokratischer Reformpolitik, dass sie die Grundannahmen der Reagan-Thatcher-Gedankenwelt stillschweigend akzeptierte. Die großen Fragen nach den Bedingungen sozialer Gerechtigkeit, nach der Bewältigung der ökologischen Fehlentwicklungen, nach einem globalen Ausgleich lassen sich auf der Basis dieses Denkens nicht beantworten.
Tony Judt war in seinen letzten Lebensjahren sehr ungeduldig. Sein letztes Buch Ill Fares The Land (2010) geht mit der gegenwärtigen Politik der westlichen Gesellschaften hart ins Gericht. Besonders Großbritannien und die Vereinigten Staaten kritisiert er scharf. In deren politischen und sozialen Systemen sieht Judt den Ausgangspunkt der Fehlentwicklungen des vergangenen Jahrzehnts – und zugleich beobachtet er dort die schlimmsten Auswirkungen. In Großbritannien und den USA sei eine Korrektur am nötigsten. Dies erklärt seine zuletzt harte Kritik an der Politik der Regierung Obama. Nicht immer war diese Kritik fair. Schließlich machte Obama bereits in seiner Antrittsrede als Präsident keinen Hehl daraus, dass er die ideologischen Entwicklungen (und ihre realpolitischen Folgen) seit Ronald Reagans Amtsantritt nach und nach rückgängig machen wollte. Bisher ist er nicht auf allen Politikfeldern erfolgreich gewesen, hat aber in zwei Jahren zumindest die Grundlagen für eine neue Politik gelegt. Diese Wiederherstellung einer auf Ausgleich, Fortschritt und Gleichheit bedachten Politik ist in ihrer Begründung und Zielsetzung – ganz im Sinne Tony Judts – nicht konservativ, sondern im Wortsinn progressiv. Judt war letztlich wie Obama ein Mann der Zukunft und des Fortschritts, und keineswegs ein „sozialdemokratischer Konservativer“, der nur Erreichtes bewahren wollte.
Aus seinen letzten Essays sprechen Trauer und die Hoffnung auf eine erneute Wende der Politik: Das einst Erkämpfte ist längst verloren, es muss – unter veränderten Bedingungen – wieder erobert werden. Dies wirft die Frage nach den Konturen zukünftiger sozialdemokratischer Politik auf: Das Gleichheitspostulat bedarf unter den Bedingungen einer globalisierten, in ihren natürlichen Lebensgrundlagen gefährdeten Welt einer neuen Begründung. Die Schwerpunkte haben sich verschoben – die Prinzipien aber blieben gleich. Judts historisches Narrativ ist eine Erzählung von Fortschritt und der Entstehung von Möglichkeiten. Aus seiner polyhistorischen Kenntnis lieferte uns der Historiker in den vergangenen Jahren wichtige Grundlagen für eine solche neue sozialdemokratische Politik. Er hinterließ ein großes Vermächtnis. Es lässt sich mit Zitaten des von ihm geschätzten George Orwell zusammenfassen. Gleich mehrmals zitiert Judt in seinen letzten Schriften Orwells Homage to Catalonia über das revolutionäre Barcelona während des Spanischen Bürgerkrieges: „Es gab vieles, was ich nicht verstand. In gewisser Hinsicht gefiel es mir sogar nicht. Aber ich erkannte sofort, dass sich für diese Verhältnisse zu kämpfen lohnte.“ Judt fügt hinzu: „Ich glaube für jeden einzelnen Bestandteil der sozialen Demokratie des 20. Jahrhunderts, den wir noch retten können, gilt dies ganz genauso.“ «